





|

|
Lärm | Lärmauswirkungen |
Lärm
Lärm gehört zu den weitest verbreiteten Belastungen der Menschheit in der heutigen Zeit. Nach einer Untersuchung des Umweltministeriums fühlt sich ein Viertel der Bevölkerung in ihrer Wohnung durch Lärm gestört. Die Belastungstendenzen hierbei sind rückläufig, was vor allem auf verbesserte Lärmschutzmaßnahmen in den Bereichen Straßen- und Wohnbau zurückzuführen ist. Als Hauptursache der Störung durch Lärm wird in einer Studie der österreichischen Bundesregierung mit 71% der Verkehr genannt.
Ruhiges Wohnen und lärmfreie Erholung stellen Ziele des Lärmschutzes dar. Es sollen Ziele erreicht werden, wonach in allen Wohngebieten die medizinisch empfohlenen Grenzwerte der Lärmbelastung eingehalten werden.
Technische Beschreibungen:
Lärm, Schall:
Im Gegensatz zum Lärm, ist nur der Schall messbar. Lärm ist ein unerwünschter, störender oder belästigender Schall, er ist kein physikalisches, sondern ein psychologisch- medizinisches Phänomen, das stark von subjektiven Einschätzungen geprägt werden kann. Daraus geht hervor, dass nur der Schall physikalisch erfassbar ist.
Schall breitet sich in Form von Schwingungen in verschiedenen Medien aus. Diese Medien können Gase (Luft), Flüssigkeiten (z.B. Wasser) oder feste Stoffe sein. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit ist von Medium zu Medium verschieden. Wahrgenommen wird der sog. Schalldruck, dies sind die durch die Schwingungen der Luftteilchen verursachten Schwankungen des Luftdrucks.
Lautstärke:
Die Lautstärke steht im unmittelbaren Zusammenhang mit der Größe des Schalldrucks. Der Schall wird umso lauter empfunden, je größer der Schalldruck bei gleicher Tonhöhe ist.
Tonhöhe:
Die Tonhöhe eines Schalls ist hingegen abhängig von der Häufigkeit der Druckschwankungen. Die Frequenz ist die Anzahl der Druckschwankungen pro Sekunde und wird in der Einheit „Hertz“ (Hz) angegeben.
Der Schalldruckpegel wird nicht, wie es in der Physik üblich wäre, in der Einheit „N/m²“ angegeben, sondern in Dezibel (dB). Da die Dezibelskala logarithmisch aufgebaut ist, ermöglicht dies, dass der sonst schwer zusammenfassbare Wahrnehmungsbereich des Gehörs, von 1 dB (Hörschwelle) bis 130 dB (Schmerzschwelle) beschrieben werden kann. Der Nachteil den diese Skala hervorruft, ist, dass für die Dezibelwerte nicht die üblichen Rechenregeln angewandt werden können. Hier stützt sich die Berechnung auf die Rechenvorschriften für Logarithmen. Vereinfacht gilt folgendes:
Wenn zwei gleich laute Schallwellen auftreten, ergeben sie in Summe eine Pegelerhöhung von 3 dB(A). 10 gleich laute Quellen erhöhen den Gesamtpegel um 10 dB(A). 60 dB + 60 dB sind also nicht 120 sondern 63 dB (A).
Physikalisches:
Auch der Einfluss der Entfernung spielt eine wesentliche Rolle auf die Ausbreitung der Schallwellen. Die Pegelabnahme mit zunehmender Entfernung ist für die Pegelabnahme von 6 dB einer Einzelquelle (z.B. Auto) und 3 dB einer Linienquelle (z.B. Strasse), je Abstandverdoppelung verantwortlich. Also wenn ein Motorrad in einer Entfernung von 10 Metern eine Lautstärke von 70 dB hat, so vermindert sich der Lärmpegel in 20 Meter Abstand auf 67 dB. Bei einer Punktquelle ergibt eine Verzehnfachung des Abstandes eine Reduktion von 20 dB. Zu beachten ist, dass die von Kraftfahrzeugen emittierten Schallwellen so genannte Zylinderwellen sind, das bedeutet, dass sich der Schall zunächst in Form eines Halbzylinders ausbreitet (horizontal zur Strasse und in Bodennähe) und anschließend mit einer gewissen Entfernung in eine Kugelwelle übergeht. Bei Zylinderwellen beträgt die Pegelabnahme bei einer Abstandsverdoppelung nur 3 dB und bei einer Verzehnfachung des Abstandes nur 10 dB.
Bodenvegetationen vermindern den Schalldruckpegel in 1,5m Höhe um 1-4 dB, da der Schall zum Teil vom Bewuchs absorbiert wird. Trotzdem ist die Abnahme des Pegels durch extra angepflanzte Grünanlagen wie z. B. dichten Hecken, sehr gering.
Eine künstliche Abschirmung ist durch Einrichtungen wie Lärmschutzwände, Wälle oder in Kombination und Häuser zu erreichen. Die Wirksamkeit einer Abschirmung ist bei künstlichen wie auch bei natürlichen Schirmen an die Höhe/Größe derselben gebunden.
Eine weitere wichtige Rolle bei der Ausbreitung des Schalls im Freien hat das Wetter. So erhöht der Schall bei einer Inversionswetterlage seine Geschwindigkeit und wird somit weiter getragen als bei „normalen“ Verhältnissen. Auch die Mitwindwetterlage gewinnt an Bedeutung, wenn Windgeschwindigkeiten von 1-3 m/s in 5 Metern Höhe verzeichnet werden und die Windrichtung vom Emittenten zum Immissionsort nicht mehr als +/- 60° abweichen. Ist dies der Fall, wird die Schallausbreitung in Windrichtung begünstigt.
Auch die Lufttemperatur und die Luftfeuchte beeinflussen die Ausbreitung des Schalls. Bei tieferen Temperaturen wird der Schall grundsätzlich weiter übertragen als bei hohen. Eine hohe Luftfeuchtigkeit führt genau zu dem gegenteiligen Ergebnis, also zu einer Abdämpfung (insbesondere von hohen) Frequenzen.
Auswirkungen auf den Menschen:
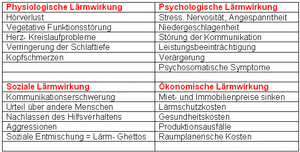
Lärm kann sich auch negativ auf die Gesundheit auswirken. Untersuchungen ergeben negative Einwirkungen am Gehörgang selbst und weiters kann Lärm eine ganze Folge von Reaktionen außerhalb des Gehörgangs starten. Bei extremem Schalldruck können feine Härchen und Hörnerven brechen, was dann zu einem Hörverlust ganz bestimmter Frequenzen führen kann. Dieser Vorgang ist irreversibel und führt daher zu bleibenden Schäden. Lärm ist auch in der Lage, eine Reihe von Reaktionen auszulösen, die einer Abweichung der psychologischen Funktion verschiedener Organe von der Norm führen.
Stress ist teilweise auch dem Lärm zuzuschreiben und dieser wirkt sich wiederum negativ auf das Herz-Kreislaufsystem aus. Eine Vermutung geht bereits soweit, dass man glaubt jeder 5. Herzinfarkt sei eine Folge des Lärms. Er kann zu Störungen im Magen und Darmbereich und zu chronischer Verärgerung führen, was sich nach neuesten Erkenntnissen negativ auf das Immunsystem auswirkt. Lärm stört Ruhe und Entspannung, stört Leistungen körperlicher und geistiger Art, beeinträchtigt das seelische Wohlbefinden, führt zur Störung des sozialen Friedens in der Nachbarschaft und führt zu einer Störung der Spracherlernung von Kleinkindern.
Auszüge aus der Diplomarbeit "Auswirkungen einer Motocross Strecke" von DI (FH) Wolfgang Engelbrecht
<< zurück
|
|
|
|





|